Seiteninhalt
Dienstwagen, Jobticket, Rabatte: Arbeitgeber können Arbeitnehmern finanzielle Vorteile verschaffen, ohne ihr Gehalt zu erhöhen. Diese Art der Zuwendung bietet für beide Seiten steuerliche Erleichterungen. Wir erläutern, welche Möglichkeiten es gibt, wann sich diese lohnen, und was zu beachten ist.
Geldwerter Vorteil Brutto Netto Rechner
Was ist ein geldwerter Vorteil?
| Art des geldwerten Vorteils | Beschreibung |
|---|---|
| Dienstwagen | Bereitstellung eines Fahrzeugs zur privaten Nutzung; Wert oft pauschal ermittelt. |
| Firmenhandy/Computer | Nutzung von mobilen Endgeräten ohne Kostenteilung für private Zwecke. |
| Kantinenessen | Verbilligte oder kostenlose Mahlzeiten während der Arbeitszeit. |
| Dienstwohnung | Bereitstellung einer Wohnung durch den Arbeitgeber; finanzieller Vorteil durch Mietersparnis. |
| Arbeitgeberdarlehen | Günstige Konditionen im Vergleich zu marktüblichen Kreditzinsen. |
| Jobticket | Zuschüsse oder Übernahme der Kosten für den öffentlichen Nahverkehr. |
| Vermögenswirksame Leistungen | Zahlungen des Arbeitgebers in Sparformen, die durch staatliche Prämien gefördert werden. |
| Sachgeschenke | Kleinere Geschenke mit einem festgelegten maximalen Wert pro Jahr. |
Als geldwerter Vorteil – auch Sachleistungen genannt – werden Einnahmen aus einem Arbeitsverhältnis bezeichnet, welche nicht in Form von Geld erbracht werden. Sie bringen dem Arbeitnehmer einen finanziellen Vorteil. Es handelt sich meist um eine verbilligte oder unentgeltliche Überlassung von Waren oder Dienstleistungen durch den Arbeitgeber.
Ein geldwerter Vorteil ist Teil der Gesamtvergütung und werden zusätzlich zum Lohn gewährt. Beispiele für geldwerte Vorteile sind Dienstwagen, die auch privat genutzt werden können, kostenfreie oder vergünstigte Mahlzeiten, Wohnung oder Rabatte auf Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens.
Ein geldwerter Vorteil entsteht, wenn ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber zusätzliche Leistungen erhält, die über das normale Gehalt hinausgehen und für den Arbeitnehmer einen messbaren finanziellen Nutzen darstellen. Diese Vorteile sind in der Regel Teil der Vergütung und gelten als Bestandteil des Einkommens, weshalb sie grundsätzlich steuer- und sozialversicherungspflichtig sind. Sie werden dem Gehalt hinzugerechnet und müssen daher oft im Rahmen der Lohnabrechnung berücksichtigt werden.
Häufige Beispiele für geldwerte Vorteile sind die private Nutzung eines Dienstwagens, die Bereitstellung eines Firmenhandys auch für private Gespräche, verbilligte oder kostenlose Mahlzeiten in der Kantine, Dienstwohnungen oder auch Arbeitgeberdarlehen zu günstigen Konditionen. Jede dieser Leistungen hat einen bestimmten Wert, der als geldwerter Vorteil betrachtet wird und zu versteuern ist, indem er zum zu versteuernden Einkommen hinzuaddiert wird.
Geldwerte Vorteile können sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber attraktiv sein, da sie eine flexible Form der Vergütung darstellen. Während Arbeitnehmer auf diese Weise zusätzliche Leistungen beziehen, profitieren Arbeitgeber oft von Steuervergünstigungen und einer höheren Bindung ihrer Mitarbeiter.
Für die genaue Bewertung und Behandlung von geldwerten Vorteilen ist es unerlässlich, die aktuellen steuerlichen Vorschriften zu beachten. Gegebenenfalls kann eine Steuerberatung sinnvoll sein, um das individuelle Potenzial solcher Vorteile optimal auszuschöpfen.
Beispiele für geldwerte Vorteile
Neben Dienstwagen und Personalrabatten gibt es eine Vielzahl weiterer geldwerte Vorteile, die eine Firma ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann. Grundlage von Gehaltsverhandlungen können auch ein Jobticket oder ein Zuschuss zur Kinderbetreeung sein. Der Spielraum für Möglichkeiten ist kaum begrenzt. Wir erläutern einige häufig vorkommende Beispiele.
| Vorteil | Erläuterung |
| Dienstwagen | Der Dienstwagen ist dann ein geldwerter Vorteil, wenn er auch privat genutzt wird. Je nachdem, wie sich dienstliche und private Nutzung zueinander verhalten, kann ein Firmenwagen trotz der nötigen Versteuerung für den Arbeitnehmer finanziell vorteilhaft sein, siehe auch Beispiel mit Berechnung |
| Jobticket | Die als Jobticket bezeichneten und durch den Arbeitgeber finanzierten „Fahrkarten“ sind zwar ein geldwerter Vorteil, jedoch muss dieser seit 2019 nicht mehr versteuert werden, wenn es sich dabei um ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr handelt. Beim Gebrauch für den Fernverkehr können dagegen bei zu häufiger privater Nutzung Steuern anfallen. |
| Personalrabatt | Personalrabatt bedeutet, dass das Unternehmen den Mitarbeitern eigene Produkte und Leistungen gratis oder vergünstigt anbietet. In welchem Rahmen dies jeder einzelne Mitarbeiter steuerfrei pro Jahr nutzen darf, ist durch den Rabattfreibetrag begrenzt, siehe Freibeträge unten. |
| Kinderbetreuung | Die durch den Arbeitgeber bereitgestellten Zuschüsse zur Kinderbetreuung oder gar eine betrieblich organisierte Kinderbetreuung dienen vor allem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es handelt sich um eine Leistung, die bei nicht schulpflichtigen Kindern zudem steuerfrei ist. |
| Gesundheitsförderung | Maßnahmen zur Prävention in Form von innerbetrieblich oder außerbetrieblich stattfindenden zertifizierten Kursen und Maßnahmen sind ein weiterer Vorteil für finanzielle Zuwendungen ohne Gehaltserhöhung. Der Arbeitgeber unterstützt damit die Aufrechterhaltung der Gesundheit der Arbeitnehmer. |
| Fortbildung | In vielen Branchen ist üblich, dass Fortbildungsmaßnahmen vom Arbeitgeber bezahlt werden. Der Betrieb hat ein Interesse an besser geschulten Mitarbeitern. Die Kostenübernahme kann auch Anfahrt und Unterkunft für außerhalb stattfindende Kurse beinhalten. |
| Gutscheine | Dies kann z.B. ein Tankgutschein, ein Warengutschein, oder auch etwas Spezielleres sein. Steuerlich wird zwischen anlassbezogenen Aufmerksamkeiten (etwa ein Geburtstag) und sonstigen Zuwendungen unterschieden. Es gelten unterschiedliche Freigrenzen, siehe Auflistung unten. |
| Vermögenswirksame Leistungen | Vermögenswirksame Leistungen sind eine Zuwendung des Arbeitgebers, die sowohl steuer- als auch sozialabgabenpflichtig ist. Der Arbeitnehmer erhält je nach Arbeitsvertrag und Branche bis zu 40 Euro pro Monat. Dennoch ist der finanzielle Nutzen für den Arbeitnehmer unter dem Strich gegeben, weshalb auch diese Möglichkeit erwähnt werden soll. |
Wie kann ich einen geldwerten Vorteil berechnen (Beispiele)?
Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist es natürlich wichtig zu wissen, wie hoch ein solcher geldwerter Vorteil ausfällt, und ob sich die Sache entsprechend lohnt. Dies soll anhand der folgenden 3 Beispiele mit einer Berechnung erläutert werden.
![Geldwerter Vorteil: Beispiele und Tipps [jahr] 2 geldwerter Vorteil: mehr Gehalt ohne Gehaltserhöhung](https://www.brutto-netto-rechner24.de/wp-content/uploads/2024/01/woman-4702060_1920-edited.jpg)
Dienstwagen
Ob ein Arbeitnehmer profitiert, richtet sich danach, wie häufig mit dem Dienstwagen private Fahrten durchgeführt werden, und wie hoch gleichzeitig die laufenden Kosten für das eigene private Fahrzeug wären. Sind die privaten Kosten höher, kann sich der Firmenwagen lohnen. Der ausgerechnete geldwerte Vorteil wird dem Bruttolohn zugeschlagen, und dann entsprechend versteuert (Lohnsteuer und Sozialabgaben sowie gegebenenfalls sonstige Abgaben). Außerdem lässt sich so auch ermitteln, in welcher Höhe gegebenenfalls eine Selbstbeteiligung seitens des Arbeitnehmers sinnvoll sein kann, um die Steuerlast zu drücken. Angewandt wird häufig die 1-Prozent-Regelung, die eine pauschale Ermittlung des geldwerten Vorteils erlaubt. Alternativ dazu kann auch ein Fahrtenbuch genutzt werden.
Berechnung: Die Formel lautet: 1 % des Listenpreises zuzüglich einfache Entfernung zum Arbeitsplatz x 0,03 % x Listenpreis. Beträgt der Listenpreis des Wagens 35.000 Euro und die einfache Entfernung vom Wohnort zum Arbeitsort 18 Kilometer, entspricht der geldwerte Vorteil: 0,01 x 35.000 € + (18 x 0,0003 x 35.000) = 539 Euro.
![Geldwerter Vorteil: Beispiele und Tipps [jahr] 3 Ein Dienstwagen ist ein geldwerter Vorteil](https://www.brutto-netto-rechner24.de/wp-content/uploads/2024/01/Autoschluessel-edited.jpg)
Personalrabatt
Beim gewährten Personalrabatt ist die Berechnung vergleichsweise simpel. Zuerst wird der für den Endverbraucher gewöhnliche Verkaufspreis (Listenpreis) als Warenwert veranschlagt. Nun kommt ein Rabatt hinzu. Der Vorteil ergibt sich aus der Differenz zwischen dem jährlichen Rabattfreibetrag in Höhe von 1080 Euro und dem sogenannten berichtigten Abgabepreis, der dem Listenpreis abzüglich 4 % entspricht. Beispielsweise bietet ein Arbeitgeber seinem Mitarbeiter einen Rabatt in Höhe von 30 Prozent auf ein im Verkauf 18.000 Euro teures Motorboot an.
Berechnung: 18.000 € x 0,96 x 0,3 – 1080 = 4104 Euro geldwerter Vorteil.
Jobticket
Auch das Jobticket ist ein geldwerter Vorteil. Der Vorteil ergibt sich aus der Differenz der Eigenbeteiligung und des tatsächlichen Ticketpreises abzüglich eines Bewertungsabschlages von 4 %. Das heißt, dass Rabatte, die beispielsweise ein Verkehrsverbund dem Arbeitgeber für Tickets für seine Mitarbeiter bietet, kein geldwerter Vorteil sind. Am Beispiel eines ÖPNV-Monatstickets, das gewöhnlich 75 Euro kostet, und durch einen Rahmenvertrag zwischen Arbeitgeber und Verkehrsverbund zu 66 Euro an Mitarbeiter abgegeben wird, soll dies verdeutlicht werden. Angenommen wird zudem eine Eigenbeteiligung von 25 Euro. Die Berechnung lautet wie folgt:
Berechnung: Tatsächlicher Preis des Tickets für Arbeitgeber x 0,96 – Eigenbeteiligung = geldwerter Vorteil. Dies entspricht: 66 Euro x 0,96 – 25 Euro = 38,36 Euro.
Zuwendungen im Zusammenhang mit ÖPNV-Tickets sind grundsätzlich steuerfrei. Für andere Tickets gilt ein Freibetrag von 44 Euro im Monat. Bei Tickets, die vom Arbeitgeber gestellt werden, aber vor allem privat genutzt werden, handelt es sich bei Werten über 44 Euro im Monat um vollständig zu versteuernde geldwerte Vorteile. Ein Beispiel hierfür ist die Nutzung einer BahnCard 100, wenn die Fernfahrten nicht zwingend beruflich nötig sind. Wichtig zu wissen: Es erfolgt eine Verrechnung mit der Pendlerpauschale: Wo der geldwerte Vorteil vorhanden ist, kann die Pendlerpauschale nicht mehr angewandt werden.
Wie muss ich geldwerte Vorteile versteuern?
Die Besteuerung von geldwerten Vorteilen ist in §8 Abs. 2 und 3 EstG gesetzlich geregelt. Die Beträge werden in der entsprechenden Höhe dem Brutto-Lohn zugeschlagen, und dann entsprechend versteuert. Zu beachten sind Freibeträge oder Freigrenzen. Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass Freibeträge mit den geldwerten Vorteilen verrechnet werden, und nur ein Übertrag besteuert wird. Bei Freigrenzen wird hingegen alles besteuert, insofern der Wert über der jeweiligen Grenze liegt. Das ist auch einer der Gründe, warum bei Jobtickets Eigenanteile anfallen. Sie ermöglichen es, unterhalb der Freigrenze zu bleiben. Einige Sachleistungen sind gar nicht steuerpflichtig, siehe folgende Tabelle.
| Keine Steuerpflicht | gibt es bei: Zuschüssen zu arbeitsbedingtem Umzug, ÖPNV-Ticket, Kinderbetreuungszuschüsse oder -stellung, Weiterbildungen und Verpflegung in Form von Obst und Getränken. Dasselbe gilt für geliehene Dinge, die im Besitz des Arbeitgebers verbleiben, aber von Mitarbeitern genutzt werden. |
| Freibeträge | können genutzt werden bei: Weihnachts- und Firmenfeiern bis zu 110 Euro pro Jahr, Rabatte und Bonusmeilen bis 1.080 Euro pro Jahr, Gesundheitsprävention: 500 Euro pro Jahr, Mitarbeiteraktien: 360 Euro pro Jahr. |
| Freigrenzen | gibt es z.B. bei: Eintrittskarten bis 44 Euro pro Monat, Geschenke: 60 Euro pro Monat, Arbeitgeber-Darlehen: 2.600 Euro pro Monat |
Was ist besser: Sachleistung oder Gehaltserhöhung?
Ist ein geldwerter Vorteil für Arbeitgeber und Arbeitnehmer wirklich lohnenswert, oder ist die normale Gehaltserhöhung die bessere Wahl? Dies hängt vor allem von der unterschiedlichen steuerlichen Bemessungsgrenze ab. Vor allem Angestellte kleiner Firmen, welche keine großen Gehaltssprünge zu erwarten haben, profitieren häufig mehr von geldwerten Vorteilen, und haben im Ergebnis mehr Netto in der Tasche. Bedacht werden sollte auch, dass Lohnerhöhungen immer mit einer stärkeren steuerlichen Belastung einhergehen. Zwar werden auch Sachleistungen versteuert, folgen dabei aber anderen gesetzlichen Gegebenheiten. In einigen Fällen bekommt ein Arbeitnehmer daher unterm Strich tatsächlich mehr heraus, wenn er sich für diese Art der Zuwendung entscheidet. Da auch der Arbeitgeber hiervon profitiert, wird in den meisten Fällen ein für beide Seiten zufriedenstellendes Ergebnis erreicht.
Ob eine Sachleistung oder eine Gehaltserhöhung die bessere Wahl ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter persönliche Präferenzen, steuerliche Auswirkungen und die individuelle finanzielle Situation.
Eine Gehaltserhöhung erhöht in erster Linie das Bruttoeinkommen eines Mitarbeiters, was sich direkt auf das Nettoeinkommen auswirkt. Allerdings muss man bedenken, dass eine Gehaltserhöhung auch mit höheren Steuer- und Sozialversicherungsabzügen verbunden ist. Dadurch fällt der tatsächliche Anstieg des Nettogehalts oft geringer aus als erwartet. Ein weiterer Vorteil einer Gehaltserhöhung ist, dass sie das Grundgehalt anhebt, was sich eventuell positiv auf spätere Lohnsteigerungen oder Berechnungen der Rentenanwartschaft auswirken kann.
Sachleistungen hingegen können in Form von steuerfreien oder steuerbegünstigten Vorteilen gewährt werden. Beispiele dafür sind Dienstwagen, Essensgutscheine, betriebliche Gesundheitsförderung oder Zuschüsse zur Altersvorsorge. Der wesentliche Vorteil von Sachleistungen liegt darin, dass sie oft steuerlich begünstigt sind, was bedeutet, dass der Mitarbeiter den vollen Wert der Leistung ohne große Abzüge erhält. Dies kann eine kosteneffiziente Möglichkeit sein, das Gesamtvergütungspaket zu verbessern. Gleichzeitig muss bedacht werden, dass Sachleistungen weniger flexibel sind und nicht direkt als Geld zur Verfügung stehen, was die Liquidität des Mitarbeiters beeinflussen kann.
Letztlich hängt die bessere Option von den spezifischen Bedürfnissen und Lebensumständen des Einzelnen ab. Wer mehr Wert auf sofortige Liquidität legt und keine spezifischen Sachleistungen benötigt, wird möglicherweise eine Gehaltserhöhung bevorzugen. Für diejenigen, die von den Vorteilen bestimmter Sachleistungen profitieren können und gleichzeitig Steuern sparen möchten, könnten Sachleistungen die bessere Wahl sein. Idealerweise sollte man gemeinsam mit dem Arbeitgeber die Optionen abwägen, um zu einer Lösung zu gelangen, die beiden Seiten Vorteile bietet.
Geldwerter Vorteil: Die Vor- und Nachteile auf einen Blick
Vorteile:
- Steuervorteile: Geldwerte Vorteile können steuerlich günstiger sein als eine reine Gehaltserhöhung, weil sie oft pauschal versteuert werden können oder bestimmte Freigrenzen und Freibeträge ausnutzen.
- Sozialversicherungsbeiträge: Unter Umständen fallen auf geldwerte Vorteile geringere Sozialversicherungsbeiträge an als auf eine Gehaltserhöhung, was sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer günstig sein kann.
- Mitarbeitermotivation: Maßgeschneiderte geldwerte Vorteile können als stärker motivierend empfunden werden, weil sie auf die individuellen Bedürfnisse des Mitarbeiters zugeschnitten werden können, zum Beispiel ein Dienstwagen oder eine betriebliche Altersvorsorge.
Nachteile:
- Flexibilität: Geldwerte Vorteile sind oft zweckgebunden und bieten dem Arbeitnehmer weniger Flexibilität als zusätzliches Bargeld, das für beliebige Zwecke ausgegeben werden kann.
- Wertempfinden: Der subjektive Wert eines geldwerten Vorteils kann je nach persönlicher Situation des Mitarbeiters variieren; nicht jeder Mitarbeiter empfindet beispielsweise einen Dienstwagen als gleich wertvoll.
- Abhängigkeit: Bei Verlust des Arbeitsplatzes gehen auch die geldwerten Vorteile verloren, während ein höheres Gehalt unter Umständen einen besseren Referenzwert für das Einkommen bei einer neuen Anstellung darstellt.
- Komplexität: Die Verwaltung von geldwerten Vorteilen kann für Unternehmen aufwendiger sein, und die Regelungen zu Versteuerung und Sozialversicherung können komplex sein.
Letztlich hängt die Entscheidung, ob ein geldwerter Vorteil oder eine Gehaltserhöhung vorteilhafter ist, von den individuellen Gegebenheiten des Arbeitnehmers und der spezifischen Situation des Unternehmens ab. Sowohl steuerrechtliche Aspekte als auch persönliche Präferenzen spielen dabei eine Rolle. Für eine persönliche Einschätzung sollte man sich immer auch fachlich beraten lassen.
Achtung, Fallstrick geldwerter Vorteil – was Sie beachten müssen
![Geldwerter Vorteil: Beispiele und Tipps [jahr] 4 Bei geldwerter Vorteil beachten](https://www.brutto-netto-rechner24.de/wp-content/uploads/2025/06/rope-3635563_1920-edited.jpg)
Ein geldwerter Vorteil liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber Leistungen erhält, die nicht in Form von Barlohn ausgezahlt werden, aber dennoch einen wirtschaftlichen Wert haben. Dazu können zum Beispiel Geschenke, die Nutzung eines Dienstwagens auch für private Zwecke oder verbilligte Kredite gehören. Hierbei gibt es verschiedene Stolpersteine und Fallstricke, die es zu beachten gilt:
1. Steuerpflicht: Ein geldwerter Vorteil ist grundsätzlich steuer- und sozialversicherungspflichtig. Er muss demnach in der Lohn- und Gehaltsabrechnung ausgewiesen und entsprechend versteuert werden – das gilt auch für Geschenke. Daher kann ein vermeintlich kostenloses Geschenk am Ende doch teuer werden.
2. Freigrenzen und Pauschalierung: In Deutschland gibt es zwar Freigrenzen (2021: 44 Euro pro Monat), bis zu denen Geschenke und andere geldwerte Vorteile steuerfrei bleiben, jedoch handelt es sich hierbei um eine Freigrenze, nicht um einen Freibetrag. Das bedeutet, dass, sobald der Wert dieser Vorteile die Grenze überschreitet, der gesamte Betrag steuerpflichtig wird. Zudem besteht die Möglichkeit, gewisse geldwerte Vorteile pauschal zu versteuern, was für den Arbeitnehmer steuerlich günstiger sein kann.
3. Sachbezugswerte: Für die Bewertung verschiedener geldwerter Vorteile gibt es festgesetzte Sachbezugswerte. Nicht immer entsprechen diese dem tatsächlichen Wert der Sache. Fehleinschätzungen können zu steuerlichen Nachteilen führen.
4. Dokumentation: Alle geldwerten Vorteile müssen korrekt dokumentiert und nachgewiesen werden. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer sollten genaue Aufzeichnungen führen, um im Falle von Prüfungen durch das Finanzamt Probleme zu vermeiden.
5. Nicht eindeutige Regelungen: Bei einigen geldwerten Vorteilen kann die steuerliche Bewertung kompliziert sein, weil die Regelungen nicht immer eindeutig sind. In solchen Fällen sollte man sich fachkundigen Rat einholen, um rechtliche und steuerliche Fehler zu vermeiden.
6. Arbeitsrechtliche Vereinbarungen: Nicht alle Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über geldwerte Vorteile sind zulässig. So können beispielsweise Vereinbarungen, die zu einer Umgehung von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen führen, sittenwidrig und damit nichtig sein.
Es ist daher empfehlenswert, sich im Zweifelsfall zum Thema geldwerter Vorteil beraten zu lassen, sei es durch Steuerberater, Fachliteratur oder die Finanzverwaltung, um nicht in Steuerfallen zu tappen.
FAQ
-
Was ist ein geldwerter Vorteil und wie wird er besteuert?
Ein geldwerter Vorteil ist ein nicht-monetärer Bestandteil des Einkommens, den Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber erhalten, wie beispielsweise einen Dienstwagen oder kostenlosen Wohnraum. Diese Vorteile werden als Teil des Einkommens betrachtet und sind daher steuerpflichtig. Der Wert des geldwerten Vorteils wird dem Bruttogehalt des Arbeitnehmers hinzugerechnet und unterliegt dann der Einkommenssteuer und meist auch der Sozialversicherung.
-
Wie wird der geldwerte Vorteil bei der privaten Nutzung eines Dienstwagens berechnet?
Für die Versteuerung der privaten Nutzung eines Dienstwagens gibt es zwei gängige Methoden: die 1-%-Regelung und das Fahrtenbuch. Bei der 1-%-Regelung wird monatlich 1 % des Bruttolistenneupreises des Fahrzeugs als geldwerter Vorteil veranschlagt. Zusätzlich fallen für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz 0,03 % pro Kilometer an. Alternativ kann ein Fahrtenbuch geführt werden, in dem die tatsächlichen Kostenanteile für private Fahrten detailliert erfasst werden.
-
Gibt es Freibeträge für geldwerte Vorteile?
Ja, es gibt bestimmte Freibeträge und Freigrenzen für geldwerte Vorteile. Zum Beispiel sind Sachbezüge bis zu einem bestimmten Gesamtbetrag pro Monat steuerfrei. Auch für bestimmte Leistungen wie die Nutzung von Internet oder Zuschüsse zu ÖPNV-Tickets können Steuerfreibeträge greifen. Die genauen Beträge können sich ändern, daher ist es wichtig, aktuelle steuerliche Regelungen zu beachten.
-
Wie wirkt sich ein geldwerter Vorteil auf die Sozialversicherung aus?
Geldwerte Vorteile sind nicht nur steuerpflichtig, sondern unterliegen in der Regel auch der Sozialversicherungspflicht. Das bedeutet, dass auf den Wert der erhaltenen Vorteile Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung abgeführt werden müssen. Diese Beiträge werden wie bei einer normalen Gehaltszahlung vom Bruttowert abgezogen.
-
Können Arbeitnehmer den geldwerten Vorteil ablehnen?
Ja, grundsätzlich können Arbeitnehmer entscheiden, ob sie einen angebotenen geldwerten Vorteil annehmen oder ablehnen. Dabei sollten sie aber die Gesamtvergütung im Blick haben, da geldwerte Vorteile oft ein attraktives Gesamtpaket ausmachen können. Bei der Entscheidung spielen persönliche Präferenzen sowie steuerliche und finanzielle Aspekte eine Rolle. Oft ist es sinnvoll, sich hierzu beraten zu lassen, um die individuell beste Entscheidung zu treffen.
Weiterführende Seiten zum Thema
- Brutto-Netto-Rechner: Wie wirkt sich eine Gehaltserhöhung auf den Nettolohn aus?
- Geldwerter Vorteil auf wirtschaftslexikon.gabler.de
- Besteuerung von Sachleistungen: gesetze-im-internet.de
- Damit der Dienstwagen nicht zur Steuerfalle wird: wiwo.de
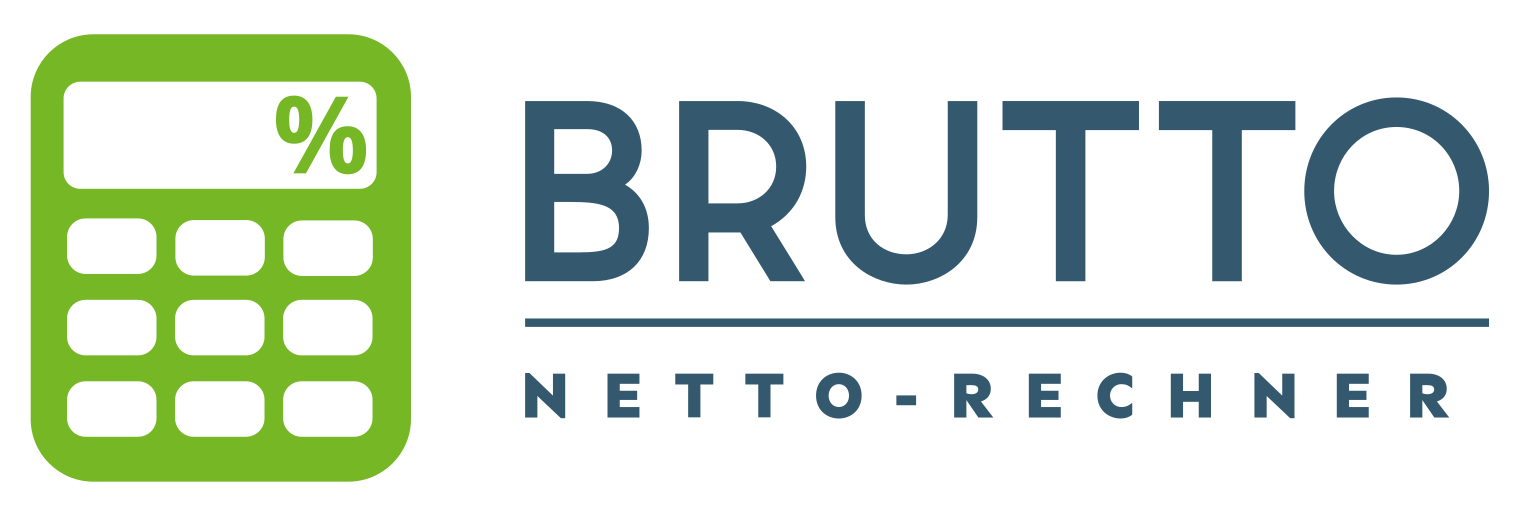

![Geldwerter Vorteil: Beispiele und Tipps [jahr] 1 Geldwerter Vorteil](https://www.brutto-netto-rechner24.de/wp-content/uploads/2014/08/Geldwerter-Vorteil-990x624.jpg)
![Bürgergeld Rechner: Wie viel bekommt man im Monat [jahr]? 8 rechner bürgergeld](https://www.brutto-netto-rechner24.de/wp-content/uploads/2025/06/coins-948603_1920-300x200.jpg)
![BAföG Rechner: So viel kann man im Jahr [jahr] beantragen 9 die besten bafög rechner](https://www.brutto-netto-rechner24.de/wp-content/uploads/2025/06/man-2562325_1920-3-300x200.jpg)
![MwSt-Rechner: Mehrwertsteuer [jahr] einfach berechnen 10 MwSt-Rechner](https://www.brutto-netto-rechner24.de/wp-content/uploads/2025/06/vat-5279689_1920-300x200.jpg)

Kommentar abgeben